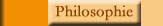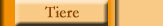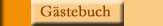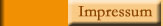Melisse - Zitronenmelisse
(Melissa officinalis L.)
Synonyme:
Bienenkraut, Citronelle, Englische Melisse, Frauenkraut, Gartenmelisse,
Herzkraut, Herztrost, Honigblume, Immechrut, Mutterkraut, Zitronenkraut,
Zitronenmelisse
Familie:
Lippenblütler (Lamiaceae)
Namensentstehung:
Der lateinische Name "Melissa" ist eine mittelalterliche Neubildung
aus dem griechischen melisso-phýllon "Bienenblatt", weil Melisse wegen
ihres Nektarreichtums eine geschätzte Trachtpflanze ist. Dieser Name
ist mit lateinisch mel "Honig" und auch mit Marmelade verwandt.
Beschreibung:
Der stark verästelte, ausdauernde Wurzelstock treibt eine bis zu
80 cm hohe Staude aus zahlreichen aufrechten, stark verästelten
Stengeln, die entfernt stehende Blätter tragen. Die zu blattachselständigen
Scheinquirlen zusammengedrängten, abstehenden oder etwas nickenden
Blüten sind bläulich bis weißgelblich. Die Pflanze hat
einen zitronenähnlichen Geruch.
Verwechslung:
Verwechslungen mit der Zitronenkatzenminze kommen häufiger vor.
Blütezeit:
Juni - August
Vorkommen:
Die Zitronenmelisse wird oft in Gewürzgärten kultiviert und
feldmäßig angebaut. Sie wächst auch an Waldrändern,
in Hecken, an Zäunen, Mauern, in Weinbergen und auf Schutt. In
Gebirgslagen ist sie häufig vollkommen eingebürgert und verwildert.
Verbreitung:
Die seit altersher bekannte Bienenfutter-, Gewürz- und Heilpflanze
stammt aus dem Orient. Ursprünglich war sie wahrscheinlich von
östlichen Mittelmeergebiet über den Kaukasus, den Iran bis
nach Südwestsibirien verbreitet. In den Alpenländern ist sie
wohl nur eingebürgert. Außer in Europa und im gemäßigten
Asien wird sie heute auch in Nordamerika häufig angebaut.
Sammelgut:
Blätter (Folia Melissae)
Sammelzeit:
Juni bis August
Sammelvorschrift:
Vor der Blüte werden die Triebe ungefähr 10 cm über dem
Erdboden abgeschnitten und die Blätter abgestreift. Man trocknet
sie möglichst rasch bei Warmluft bis zu 40°C, wobei sie öfter
gewendet wird. (Gemeint ist hier warme Umgebungsluft und nicht der Umluftherd)
Blätter von blühenden Pflanzen sind nicht zu sammeln, weil
sich während der Blütezeit die Wirkstoffe der Pflanze verändern.
Die Droge riecht zitronenartig und hat einen schwach zitronenartigen,
leicht würzigen Geschmack. Während der Blütezeit geht
von der Pflanze ein unangenehmer Geruch aus.
Zu den Hinweisen zum Sammeln
und Trocknen
von Kräutern.
Inhaltsstoffe:
Melissenblätter enthalten nicht mehr als 0.1% ätherisches Öl, das von
komplexer und variabler Zusammensetzung ist. Bisher wurden über 50 Aromakomponenten
identifiziert, worunter Citronellal (und zwar das (R)-Enantiomer, siehe
auch Kaffernlimette), ß-Caryophyllen, Nereal, Geranial, Citronellol
und Geraniol mit zusammen etwa 70% die wichtigsten sind. Melissenöl
ist dem des Zitronengrases recht ähnlich, kann aber durch ein typisches
Muster an chiralen Verbindungen unterschieden werden; so dient das Vorkommen
von enantiomerenreinem (+)-(R)-Methylcitronellat als Indikator für echtes
Melissenöl. Die beiden Öle können auch durch genaue Messung des 13-C-Gehaltes
(isotope ratio mass spectrometry, IRMS) unterschieden werden.
(Pharmazie, 50, 60, 1995)
Anwendung:
Innerlich als Tee angewendet wirkt Melisse
beruhigend und entspannend, nervenstärkend,
krampflösend,
gallensaftfördernd, schmerzstillend,
narbenrückbildend, und findet
Anwendung bei Unruhezuständen, Schlafstörungen,
Schulstress, Erkältungskrankheiten,
Neuralgien, Migräne,
Hüftschmerzen,
Herzbeschwerden, Magen-
und Darmbeschwerden, Blähungen,
Ohrenschmerzen,
Menstruationsbeschwerden, unregelmäßiger
Menstruation, Schwangerschaftserbrechen
. Man trink morgens nüchtern, und abends vor dem Schlafengehen
jeweils eine Tasse Melissentee.
Äußerlich wirkt Melisse zum Beispiel als Melissengeist
gegen Zahnschmerzen, Lippenbläschen, Rheumatismus,
hautabschwellend sowie bakterien-
und pilzhemmend.
Auszüge aus Melisse zeigen antibakterielle Wirkungen. Eine Hemmwirkung
von Melissenöl bei 36 von 43 untersuchten Bakterienstämmen konnte nachgewiesen
werden. Die Gerbstoffe entfalten eine bakterienhemmende Wirkung. Eine
Wirkung auf Herpes simplex ist nachgewiesen.
Rosmarinsäure entfaltet antivirale, antimikrobielle, entzündungshemmende
und antioxidative Wirkungen. Melissenöl
kann man selber herstellen, sollte es dann aber nicht mehr verdünnen.
10%iges Melissenöl kauft man in der Apotheke.
In Mitteleuropa aromatisiert man süße Getränke
manchmal mit frischen Melissenblättern, die sich ganz allgemein als
leicht extravagant schmeckende Dekoration eignen. Sie werden besonders
zu Fisch, Geflügel und Salaten empfohlen. Man kann allen Speisen die
mit Zitronensaft gesäuert werden, Melissenblätter zur Verstärkung
des Zitronengeschmackes zuzusetzen. Hierfür sollte man
frische Blätter verwenden.
Zitronenmelisse paßt auch sehr gut zu verschiedenen Obstsorten,
vor allem Äpfeln. Oft würzt
man mit ihr apfelhaltige Desserts. Auch andere Zubereitungen aus Früchten
kann man mit Melisse verfeinern. Kräuteressig,
der ja meistens aus Apfelessig hergestellt wird, kann ebenfalls von
Melissenzugabe profitieren.
Nebenwirkungen:
Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen und Risiken
bekannt.
Geschichtliches:
Schon die alten Griechen kannten die Heilkraft der Melisse und auch
den Römern war sie bekannt. 23-79 n. Chr. wurde die Melisse als Heilmittel
gegen allgemein nervös bedingte Beschwerden empfohlen.
|

Zeichnung: Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)
Bei Klick auf das Bild sehen Sie das Bild in einer Grösse
von 1000 Pixeln Breite
(lange Ladezeit!)

Bilder mit freundlicher Genehmigung
von
Kurt Stübers
Foto: © L. B. Schwab
Ganze Pflanze

Blüte

|