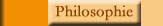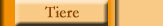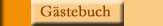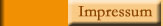Pestwurz
(Petasites hybridus L.) Nebenwirkungen
beachten!
Synonyme:
Bachbletzen, Balsternblätter, Bullerblatt, Eselsfußblümle,
Giftwurz, großblättriger gemeiner Huflattich, große
Roßhube, Hustblacken, Kraftwurz, Kröpfen, Kuckucksblume,
Lattkenblätter, Neunkraft, Pestasites officinalis Moench, rote
Geißkröpfe, Schweißwurz, Tussilago Pestasites L., Wasserklette
Familie:
Korbblütengewächse (Asteraceae)
Namensentstehung:
Griech. Petasos = hutförmig. Einige Quellen sagen, der Name "Pestwurz"
käme daher, daß die Pflanze früher gegen die Pest eingesetzt
worden sein soll, andere sagen es bezieht sich auf den Namen Petasites.
Beschreibung:
Die rötlich-weißen bis schmutzig-roten, kleinen Blüten
wachsen als endständige Traube an einem 10 - 40 cm hohen, hohlen
und dicken Stengel. Insgesamt sieht das etwas kolbenartig aus. Später
streckt sich der Kolben nochmal bis zu 1 m und den einzelnen Blüten
wächst ein Stiel, wodurch das Ganze den kolbenartigen Charakter
verliert. Die Blütenkolben erscheinen vor den Blättern im
März bis Mai. Die Blätter ähneln denen des Rhababer oder
auch des Huflattichs. Sie sind herzförmig, am Rand ungleichmäßig
gezähnt, unterseits graubehaart und erreichen einen Durchmesser
von bis zu 1 m. Damit sind sie die größten Blätter Mitteleuropas.
Verwechslung:
Blätter mit dem Huflattich
oder Rhababer, wobei bei Rhababer die Blätter unten aus einer Wurzel
kommen, während bei der Pestwurz die Blätter vertreut wie
beim Huflattich vorkommen.
Blütezeit:
März - Mai
Vorkommen:
Schwemmböden, Fluss-, See- und Bachufer, Aufschüttungen
Verbreitung:
.Europa, Nordamerika, Asien
Sammelgut:
Blätter (Folia Petasitidis)
Wurzel (Rhizoma Petasitidis)
Sammelzeit:
Wurzeln: 1. Frühling
Blätter: Mai
Sammelvorschrift:
Das Sammelgut wird an einem luftigen, trockenen Ort nicht zu heiß
getrocknet. Die Wurzel hat einen starken, guten Geruch und bitteren,
scharfen, etwas gewürzhaften Geschmack. Das Gleiche trifft auf
die Blätter zu, nur weniger intensiv.
Zu den Hinweisen zum Sammeln
und Trocknen
von Kräutern.
Inhaltsstoffe:
Schwankende Pyrrolizidinalkaloide, Pestasinen, ätherische Öle
Anwendung:
Früher schrieb man der Pestwurz herzstärkende Kräfte
zu, auch sollte sie gegen Würmer und als schleimlösendes
Mittel bei bronchialen Erkrankungen helfen. Als Hustenmittel
wurde die Pestwurz auch bei Pferden und Hornvieh verwendet. Äußerlich
wurde sie gegen bösartige Geschwüre und Hauterkrankungen
verwendet.
Sebastian Kneipp sagt, daß man die Blätter der Pestwurz
wie die des Huflattichs verwenden
kann.
Im Kräuterbuch von Losch (1914) wird aus einem nicht näher
erwähnten Kräuterbuch folgendes zitiert:
Es ist in vieler Erfahrung befunden worden, daß diese Wurzel
wider die Pest behilflich ist, das Pulver eines halben Lots schwer (7,5
gr) in gutem weißen Wein eingenommen und danach geschwitzt; dann
jagt sie das Gift mit Gewalt durch den Schweiß. Sie hat auch großes
Lob wider das Grimmen und den Krampf der Mutter, in obiger Art eingemonnen.
Etliche Roßärzte brauchen diese Wurzel für die Würmer
und das Keuchen der Pferde. Es wird auch das Pulver von der Wurzel mit
Erfolg für die Würmer den Kindern gegeben, ebenso wider die
Harnstrenge. Weitere Eigenschaften hat sie wie der Huflattich.
Pestwurz-Tee bereitet man aus zwei Teelöffeln des getrockneten Krautes,
das man mit einem Viertelliter kochendem Wasser übergießt. Nach 15 Minuten
seiht man ab und trinkt zwei bis dreimal täglich eine Tasse.
In neueren Studien wird Pestwurzextrakten aus den Blättern eine
heilkräftige Wirkung gegen Migräne und Heuschnupfen
bescheinigt. Die Migräneattacken sollen um 50% abnehmen und gegen
Heuschnupfen sollen sie die gleiche Wirkung haben wie Antihistaminika.
Nebenwirkungen:
Nicht in großen Mengen oder auf Dauer einnehmen. Nicht anwenden
bei vorbestehender Leberschädigung. Bei Schwangerschaft oder Stillzeit
den Arzt befragen.
Eine Notiz in einem uralten Kräuterbuch sagt, daß man die
Pestwurz nicht bei Fieber und anderen hitzigen Krankheiten geben darf,
da sie dann schadet. (Eigentlich logisch wenn sie die Leber belastet)
2002 wurde eine Studie veröffentlicht, nach der das gewonnene
Extrakt aus den Pestwurzblättern die gleichen Wirkungen haben,
wie Antihistaminika . Da es aber Fälle von Leberschädigungen
durch die Fertigpräparate gab, wurde die Zulassung 2004 in der
Schweiz wiederrufen. Das toxikologische Institut der Schweiz warnt davor
die selber gesammelte Pestwurz anzuwenden, da der unterschiedliche Gehalt
der leberschädigenden Pyrrolizidinalkaloide der Pflanze nicht angesehen
werden kann.
Geschichtliches:
Pestwurz spielt schon seit Jahrhunderten eine Rolle in der Heilkunde.
Verwendet wurde die Wurzel auch gegen die Pest, wobei sie vermutlich
eher des Namens wegen gegen die Pest verwendet wurde, als daß
der Name von der Verwendung stammt.
|

Zeichnung: Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)
Bei Klick auf das Bild sehen Sie das Bild in einer Grösse
von 1000 Pixeln Breite
Bild mit freundlicher Genehmigung von Kurt
Stübers
Fotos © L. B. Schwab


 < <
Bei Klick auf ein Foto sehen Sie es in einer Grösse
von 500 Pixeln Breite
|