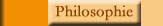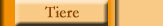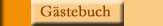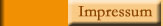Gemeiner Beifuss
(Artemisia vulgaris L.)
Synonyme:
Beipes, Biwes, Buckerle, Gänsekraut, Magert, Mutterkraut, Wermet
Familie:
Korbblütengewächse (Asteraceae(Compositae)))
Namensentstehung:
Das Wort Beifuß ist eine Abwandlung des mittelhochdeutschen
biboz (bozen = stoßen), da dieses Gewürz zur Speise gestoßen
wurde.
Beschreibung:
Die l bis 2 m hohe Staude hat einen mehrköpfigen, ästigen
Wurzelstock, treibt mehrere aufrechte, alljährlich absterbende,
runde, geriefte, rispenartig verzweigte Stengel. Die 5 bis 10 cm langen,
derben Laubblätter sind am Rand oft etwas umgerollt und auf der
Unterseite weißfilzig. Die unteren Blätter sind bis zu 10 cm lang, gestielt, 1-2fach
fiederteilig, mit lanzettlichen, spitzen, ganzrandigen oder wenigzähnigen,
3-6 mm breiten Abschnitten. Die 3-4 mm langen Blütenköpfchen stehen zahlreich in einer, reichverzweigten,
von lanzettlichen Hochblättern durchblätterten Rispe. Sie sind eiförmig,
kurz gestielt und stehen aufrecht. Die zweireihige Blütenhülle der
Einzelblüte ist aus schuppenförmigen, hautrandigen, grauweißen Blättchen,
die mehr oder weniger filzig sind und sich schindelartig abdecken.
Die äußeren sind kurz, lanzettlich und spitz, die inneren größer,
länglich und stumpf. Die die Hülle wenig überragenden Blüten sind
gelblich oder rotbraun. Sie stehen auf einem kegelförmigen, nackten
Blütenboden. Die Früchtchen sind sehr klein, graubraun und fein gestreift.
Die ganze Pflanze hat einen eigenartigen Geruch
Verwechslung:
Mit Wermut
Unterscheidung: die Blüten des Beifuß sind aufrecht, die vom Wermut nickend. Wermut ist komplett silbrig pelzig behaart.
Blütezeit:
Juli bis September
Vorkommen:
Der Beifuß kommt besonders auf nährstoffreichen Sand-,
Kies- und Lehmböden vor und besiedelt nitratreiches Ödland.
Man findet ihn auch in Bauerngärten als Gewürzpflanze. In
Deutschland ist es eigentlich überall vertregten. Man findet
es auf jeder Verkehrsinsel, an Wegen, auf Wiesen und an Bahndämmen.
Verbreitung:
Die Pflanze ist fast auf der ganzen nördlichen Halbkugel verbreitet
und in Nord- und Mittelamerika sowie in Zentralasien, wo sehr wahrscheinlich
der Ursprung der ganzen Gruppe zu suchen ist, mit zahlreichen Unterarten
vertreten.
Sammelgut:
Kraut (Herba Artemisiae)
Sammelzeit:
Juli bis September
Sammelvorschrift:
60 bis 70 cm des blühenden Krautes werden abgeschnitten, gebündelt
und getrocknet. Die Droge riecht angenehm würzig und schmeckt aromatisch,
ein wenig bitter.
Zu den Hinweisen zum Sammeln
und Trocknen
von Kräutern
Inhaltsstoffe:
Das ätherische Öl (nur 0.03 bis 0.3%) enthält eine Vielzahl verschiedener
Terpene und Terpenderivate, z.B. 1,8-Cineol, Kampfer, Linalool, Thujon,
4-Terpineol, Borneol, a-Cardinol und weitere Mono- und Sesquiterpene.
Die Zusammensetzung schwankt quantitativ und qualitativ in Abhängigkeit
von Boden, Klima, Dünger und Erntezeitpunkt. Thujon, ein Monoterpenketon,
ist giftig; es kommt auch im Salbei
vor und wird für die verheerende Wirkung des Absinth verantwortlich
gemacht.
Anwendung:
Eigenschaften: appetitanregend, verdauungsfördernd, entkrampfend
Früher hat die Volksmedizin keinen Unterschied zwischen Wermut und Beifuß gemacht, denn die Heilanzeigen für den
Wermut, gelten auch für den Beifuß. Er wirkt gegen Fäulniß und reinigt. Deshalb wird Beifuß bei Appetitlosigkeit,
Verdauungsstörungen, Magenbeschwerden,
Blähungen, Nervenkrankheiten, Menstruationskrämpfen, zur Auslösung der Menstruation bei unregelmäßigen Blutungen und gegen Hämohorriden verwendet.
Auch heute noch schwören Anwender darauf, daß die Wurzel des Beifuß als Tee oder Tinktur, hilfreich bei Epilepsie sei.
Einen Tee bereitet man wie folgt:
1 Teelöffel Kraut mit 1/4 Liter kochendem Wasser übergießen und maximal 5 Minuten ziehen lassen. Man darf diesen Tee nicht
süssen, da sonst seine Bitterstoffe neutralisiert werden. Und Beifußtee schmeckt sehr bitter. Wem das zu bitter
ist, der läßt den Tee nur 2 - 3 Minuten ziehen.
Das Kraut des Beifuß als Fußbad wirkt entspannend, krampflösend und wohltuhend und kann bei Unterleibskatarrhen und Eierstockentzündungen und Rheuma
gemacht werden
Beifuß in der Küche:
Er gehört zu den stark aromatischen Gewürzkräutern und wird
vor allem fetten Fleischgerichten, aber auch Suppen und Eintöpfen zugesetzt. Besonders bei fettem
Gänsebraten
fördert er den Geschmack und die Bekömmlichkeit.
Der Geschmack von Beifuß ist etwas wacholderartig.
Eine leckere Gewürzmischung macht man aus 5 Teilen Beifuß, 3 Teilen Basilikum, 2 Teilen Thymian, und 2 Teilen Rosmarin. Man
verwendet die getrockneten Kräuter und verreibt sie fein zu einem Pulver.
Aus 1 Teil Beifuß, 1 Teil Rosmarin und 2 Teilen Thymian, mit Salz zusammen fein vermahlen, macht man ein sehr
aromatisches Kräutersalz.
Beifuß homöopathisch:
Artemisia vulgaris wird aus der Wurzel hergestellt und vornehmlich als Ergänzung einer Behandlung bei Epilepsie
verordnet.
Beifuß als Räucherkraut:
Mit Genehmigung des Verfassers:Räucherwerkstatt
Sicherlich wissen viele von euch, daß der Beifuß schon bei den Kelten eine heilige Pflanze war.
Er war vor allem ein Frauenkraut, mit dessen Rauch der Unterleib der Frauen geräuchert wurde, zur Reinigung,
Heilung, Stärkung und auch als Segen.
Für mich ist der Beifuß ein Meisterkraut, daß ich in vielen meiner Räuchermischungen verwende.
Beifuß reinigt und schützt, er kann unsere Selbstheilungskräfte für Leib und Seele aktivieren.
Wärme und Entspannung vermittelt sein Rauch. Mit ihm wurde tratitionell Haus und Stall gereinigt, vor allem
an den Sonnwenden.
Der Beifuß dient uns als Schwellenpflanze und öffnet uns die Möglicheit bei Visionsräucherungen mit der Anderswelt
Kontakt aufzunehmen, wobei er uns aber auch schützend umgibt.
Hier kann man über Beifuß als Räucherkraut mit Synergy (Walter)
von der Räucherwerkstatt diskutieren.
Die Räucherzigarren oder auch Räucherkegel (Moxa) mit denen entweder Akkupunkturpunkte direkt oder indiekt Akkupunkturnadeln erwärmt werden,
werden aus Beifuß gemacht. Für die traditionell chinesischen wird japanisches Moxakraut, Artemisia princeps, TCM = huang hua ai , japanisch = yomogi verwendet. (Danke Dagmar für's nachgucken)
Beifuß im eigenen Garten:
Beifuß ist ausdauernd und frosthart. Er braucht etwa 40 cm Abstand zur nächsten Pflanze. Vollschatten mag
er nicht so sehr, aber sonst anspruchslos ans Licht. Normal feucht halten. Beifuß ist ein Lichtkeimer, er lässt sich aber
auch durch Wurzelteilung vermehren. Die Aussaat im Freiland sollte nach dem Frost geschehen. Vorzucht in Töpfen ab März möglich.
Nebenwirkungen:
Achtung! In der Früh-Schwangerschaft nicht verwenden, da er durch seine Menstruationsförderung Fehlgeburten
auslösen könnte. Nicht bei akut entzündlichen Erkrankungen verwenden. Beifuß gilt als Auslöser von Heuschnupfen.
Wer nicht schwanger ist, braucht bei einer normalen Dosierung keine Nebenwirkungen zu befürchten, wobei Allergien auf Beifuß
nicht ausgeschlossen sind.
Geschichtliches:
Im Altertum wurde Beifuß häufig verwendet, so bei Wassersucht,
Epilepsie und bei Bissen giftiger Tiere. Der Göttin Artemis geweiht, verwendet man den Beifuß schon früh für Liebeszaubereien.
In die Glut geworfen, sollte er alle bösen Zaubereien fern halten. Man glaubte, wer Beifuß im Haus hat, könne nicht vom Teufel
geholt werden. Wer Beifuß in den Kleidern trug, konnte weder vom Blitz getroffen, noch von einer Hexe
geholt werden. Heilkundige Frauen haben früher
ihren Töchtern Gürtel aus Beifuss geflochten oder Zweige
um den Bauch gebunden, damit aus ihnen mal eine starke Mutter wird.
Quellen:
Was blüht denn da?,
Die Kräuter in meinem Garten,
Das große Buch der Heilpflanzen,
Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch,
Kräuter und Heilpflanzenkochbuch,
Essbare Wildpflanzen,
Die große Enzyklopädie der Heilpflanzen,
andere nicht mehr nachvollziehbare Quellen und eigene Zettelwirtschaft.
|

Bei Klick auf das Bild sehen Sie es nochmal in einer
Grösse von 1000 Pixeln Breite
(lange Ladezeit!)

Bilder mit freundlicher Genehmigung von
Kurt Stübers

Foto der getrockneten Pflanze
© by Käsekessel


Bei Klick auf ein Foto sehen Sie es nochmal etwas größer.
|