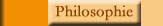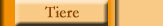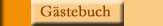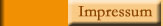Schlehe
(Prunus spinosa)
Synonyme:
Bockbeerli, Haferpflaume, Hagedorn, Heckendorn, Kietschkepflaume, Schlehdorn,
Schwarzdorn
Familie:
Rosengewächse (Rosaceae)
Namensentstehung:
spinosa = stachelig. Prunusarten sind mir eigentlich sonst nur als Kirschen
bekannt.
Beschreibung:
Der sparrige, dicht verzweigte Strauch wird bis zu 3m hoch und 2 - 4
m breit. Bevor die ersten Blätter sprießen, zeigen sich die
zahlreichen, kleinen, leuchtendweißen, duftenden Blüten,
die meist einzeln stehen, aber so dicht über die ganze Zweiglänge
verteilt sind, dass der ganze Strauch weiß erstrahlt und so zahlreiche
Insekten anzieht. Die Staubbeutel sind gelb bis rötlich. Nach der
Blüte entwickeln sich im Mai die gesägten, ovalen Blätter.
Die Steinfrüchte ähneln der Pflaume, haben ein grünes,
saures Fleisch und einen Durchmesser von 1 cm. Ihre Farbe ändert
sich von grün im unreifen Zustand, bis ins blaugrau wenn sie reif
sind. Erst nach dem ersten Frost sind sie genießbar. Die Stacheln
der Schlehe sind umgewandelte Seitentriebe und recht lang und spitz.
Die Wurzeln kriechen sehr weit und treiben Sprossen, durch die sich
die Schlehe neben der Verbreitung der Kerne in den Früchten vermehren.
Verwechslung:
Mit dem Weißdorn, da die Blüten
recht ähnlich sind. Allerdings sind die Dornen beim Weissdorn richtige
Dornen und keine umgebildeten Äste. Die Früchte des Weißdorn
sind rot und die Blätter erinnern an verkürzte Blätter
einer Eiche.
Blütezeit:
März - April
Vorkommen:
Sonnige Hügel, trockene, lichte Laubwälder.
Verbreitung:
Ursprünglich aus dem Orient stammend, heute von Schottland und
Südskandinavien in den Osten hin bis zum Ural, in Vorderasien,
Nordafrika und Nordamerika.
Sammelgut:
Blüten und Früchte
Sammelzeit:
Blüten: März - April
Früchte: Nach dem ersten Frost
Sammelvorschrift:
Schlehenblüten sollen bei trockenem Wetter noch vor dem Erscheinen
der Blätter gesammelt werden, Man darf sie während des Trocknens
nicht umwenden. Die Farbe der getrockneten Droge soll eilfenbeinähnlich
sein. Bräunlich verfärbte oder von Insekten befallene Blüten
sind auszusondern. Im frischen Zustand haben sie einen süßlichen
Geruch und einen bitteren Geschmack. Der Geruch verliert sich beim Trocknen.
Zu den Hinweisen zum Sammeln
und Trocknen
von Kräutern.
Inhaltsstoffe:
Schlehenfrüchte:
Vitamin C, Flavonoglykoside, Cumarinderivate, Gerb- und Bitterstoffe,
Säuren, Spuren von Amygdalin (Blausäureglukosid).
Schlehenblüten: Flavonoide, vornehmlich Kämpferolglykoside,
Quercetin, Quercitrin, Rutin, Hyperosid, und Spuren von Amygdalin (Blausäureglukosid).
Anwendung:
Die Schlehe wirkt asdstringierend (zusammenziehend), schwach abführend,
entzündungshemmend, magenstärkend
und harntreibend. Die getrockneten
Blüten werden als Teeaufguß zur Blutreinigung bei Hautkrankheiten
und bei rheumatischen Beschwerden verwendet. Diesen Tee setzt man wie
folgt an: 2 Teel. der Blüten mit 1/4 l kaltem Wasser übergießen,
langsam bis zum Sieden erhitzen und dann absieben. Täglich sollte
man 2 Tassen davon trinken.
Auch als Gurgelmittel bei leichten Entzündungen
der Mund- und Rachenschleimhaut finden Schlehenblüten
ihre Verwendung.
Aus den Beeren der Schlehe lässt sich Marmelade,
Punsch oder andere Leckereien machen.
Hier ein paar Rezepte.
Die Schlehe ist ein wichtiger Bestandteil in natürlichen Hecken,
denn grade zusammen mit anderen Rosengewächsen bildet sie ein undurchdringliches
Dornengestrüpp, dass vielen Tieren Schutz und Nahrung bietet. So
braucht zum Beispiel der Neuntöter die Schlehe, um seinen Futtervorrat
an Mäusen an den Dornen aufzuspießen. Auch von Bienen wird
die Schlehe gerne besucht. Insgesamt finden 137 Kleinlebewesen im Schlehenbusch
Nahrung, davon sind allein 73 Kleinschmetterlinge.
Auch 18 Wildbienenarten finden Gefallen an der Schlehe.
Da die Schlehe sehr windbeständig ist, eignet sie sich hervorragend
zur Befestigung von Böschungen und als Schneeschutzgehölz.
Nebenwirkungen:
Bei großer Menge der Beeren eventuell Übelkeit, Erbrechen und Durchfall.
Bei Schlehenblüten sind mir keine Nebenwirkungen bekannt
Die Schlehe ist trotz des Blausäureglukosid nicht giftig
Geschichtliches:
Vorgeschichtliche Funde weisen darauf hin, daß die Schlehe spätestens
in der jüngeren Steinzeit in Mitteleuropa heimisch war, da in aus
jener Zeit stammenden Schweizer Pfahlbauten häufig Steine der Schlehe
gefunden wurden.
|
 Zeichnung: Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)
Zeichnung: Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)
Bei Klick auf das Bild sehen Sie das
Bild in einer Grösse von 1000 Pixeln Breite
(lange Ladezeit!)

Bild mit freundlicher Genehmigung von
Kurt Stübers
|