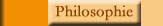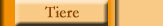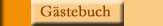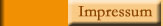Löwenzahn
(Taraxacum officinale Web.)
Synonyme:
Ackerzichorie, Bimbaum, Butterblume, Hundeblume, Kettenblume, Kuhblume,
Kukucksblom, Lampe, Lichtblom, Milchstock, Pfaffendistel, Pfaffenröhrlein,
Pferdeblume, Pusteblume, Ringelblume, Seicherwurzel, Wiesenlattich /p>
Familie:
Korbblütengewächse (Asteraceae (Compositae))
Namensentstehung:
Die Pflanze bekam ihren Namen wegen ihrer gezahnten Blätter.
Der Name "Butterblume" stammt daher, dass man früher
mit Löwenzahn Butter gefärbt hat.
Beschreibung:
Die lange Pfahlwurzel dringt bis in tiefere Bodenschichten. Sie ist
schwarzbraun und am Hals schwach wollig behaart. Sie erreicht Fingerstärke,
ist innen weiß und führt wie die ganze Pflanze Milchsaft.
Der Wurzelstock ist oft mehrköpfig. Die langen und lappigen, stark
schrotsägeartigen Blätter, die der Pflanze ihren Namen gegeben
haben, bilden eine grundständige Rosette. Die einzeln bis zahlreich
zusammenstehenden einköpfigen Blütenschäfte sind hohl
und völlig nackt. Der Blütenhollkelch setzt sich aus vielen
Hüllenblättchen zusammen, deren innere aufrecht stehen und
den Blütenkopf umhüllen. Später wird der Fruchtboden
fast kugelig, indem sich sämtliche Blättchen des Hohlkelches
zurückschlagen. Die Köpfe tragen zahlreiche gold- und hellgelbe
Blüten. Die hellen bis schwarzen Früchtchen haben eine weiße,
strahlenförmig ausgebreitete Haarkrone (Pappus), mit der sie der
Wind weit verweht. Schwacher Geruch und schwach bitterer Geschmack.
Wiesen-Löwenzahn wird 10 bis 50 cm groß.
Obwohl er zur Samenbildung keiner Bestäubung durch
Insekten bedarf, spendiert der Löwenzahn Bienen und vielen anderen
Besuchern Pollen und Nektar. Der Löwenzahn braucht keine Befruchtung,
sondern er pflanzt sich durch eine eingeschlechtliche Samenbildung fort.
Deshalb haben sich weltweit über 2300 Arten gebildet, die auf Grund
von Mutationen entstehen. Durch die eingeschlechtliche Fortpflanzung
bleiben diese Mutationen leichter erhalten, wogegen sie sich bei zweigeschlechtlicher
Fortpflanzung eher verwächst. Ein vom Namen her bekannter Löwenzahn
ist der Herbstlöwenzahn (Leontodon autumnalis). Wie sein Name
schon sagt, ist seine Hauptblütezeit im Herbst. Er könnte durchaus mit
dem Wiesenlöwenzahn verwechselt werden. Allerdings ist der Stengel des
Herbstlöwenzahn nicht hohl wie der des Wiesenlöwenzahns (Taraxacum
officinale).
Trotz des reichen Nektarangebots des Löwenzahn, muss
eine Biene für ein Kilo Honig 125.000 Blütenkörbchen
besuchen.
Verwechslung:
Herbstlöwenzahn mit dem gewöhnlichen Löwenzahn. Unterscheidung
ist die Blütezeit und die Form der Blätter. Der Stengel des
Herbstlöwenzahns ist nicht hohl.
Blütezeit:
April - September
Vorkommen:
Als außerordentlich anspruchslose Art gedeiht sie fast überall,
vor allem an Wegrainen, in Hecken, auf Äckern und Schuttplätzen,
in Brachland und lichten Wäldern und auf Wiesen, die sie zur Blütezeit
fast gänzlich gelb zu färben vermag. Hartnäckig allem Beton
zum Trotz, nutzt er die kleinste Ritze um sich zu entfalten.
Verbreitung:
Die Pflanze ist über den größten Teil der nördlichen
Halbkugel verbreitet.
Sammelgut:
Ganze Pflanze mit Wurzel (Radix Taraxci cum herba)
Sammelzeit:
April - Mai
Sammelvorschrift:
Im April und Mai wird die ganze Pflanze vor der Blütezeit mit der
Wurzel gestochen. Nach dem Befreien von anhaftenden Erdresten wird sie
bei künstlicher Wärme bis zu 40 Grad Celsius getrocknet. Später
wird sie zerkleinert. Sie hat jetzt einen schwachen Geruch und einen
bitteren Geschmack. Die Pflanze ist vor Licht und Feuchtigkeit geschützt
aufzubewahren
Zu den Hinweisen zum Sammeln
und Trocknen
von Kräutern.
Inhaltsstoffe:
Die Pflanze enthält in der Wurzel bis zu 25% Inulin, einen für
die Korbblütler charakteristischen Zucker, die Bitterstoffe Taraxacin
und Flavonoide, aetherisches Öl, Gerbstoff, Harz und Kautschuk,Xanthophylle.
Sie enthält viele Vitamine und Mineralstoffe, besonders Eisen, Vitamin
A und C. Daher wird er gerne als Rohkost Salat verwendet.
Anwendung:
Löwenzahnwurzeltee hat eine hohe blutreinigende
Wirkung und hilft dadurch bei Gicht, Störung der Galle-,
Leber- und Nierenfunktion, Rheuma, Blutkrankheiten,
Hautkrankheiten die ihre Ursache im Blut haben, Appetitlosigkeit,
Darmträgheit, Fettsucht, Alterserscheinungen,
Zuckerkrankheit. Die Wurzel hat eine stärkende, schweißtreibende
Kraft und wirkt harntreibend.
Am Wirkungsvollsten ist der frisch gepresste Preßsaft, von dem man
2 - 3 El. täglich über 3 - 4 Wochen hinweg nehmen soll. Aber
auch ein Tee aus 1 Teil Löwenzahnwurzeln und 1 Teil getrockneter
Löwenzahnblätter tut seine Wirkung. Man übergießt
von dieser Mischung 2 Teel. mit 1/4 Liter kochendem Wasser und lässt
5 - 10 Minuten ziehen. Von diesem Tee trinkt man 2 - 3 Tassen schluckweise
über 3 - 4 Wochen.
Die im Frühjahr gesammelte Pflanze hat einen geringen Inulingehalt
und wird als Bittermittel bei Appetitlosigkeit und Magenbeschwerden
gebraucht. Die Pflanze wirkt auch gallenflußfördernd und ist
Bestandteil von Leber- und Gallentees.
Löwenzahn ist aber auch als Salatbeigabe bekömmlich. Durch seinen
etwas bitteren Geschmack ist er als alleiniger Salat etwas zu derbe. Frische
Löwenzahnblätter im Salat helfen gegen die Frühjahrsmüdigkeit. In China
werden die zarten, jungen Blattsprosse gekocht.
Auch in der chinesischen Medizin ist der Löwenzahn nicht unbekannt.
Sie verwendet die ganze Pflanze als Heilmittel. Die Pflanze wird komplett
ausgegraben, gesäubert und in der Sonne getrocknet. Bei Leber- und
Gallenbeschwerden nebst der dazugehörigen Begleiterscheinungen wie
Angespanntheit, Übelkeit oder Reizbarkeit, werden 6 - 8 Pflanzen
in 2 Dosen auf leerem Magen, 10 Tage bis 2 Wochen lang eingenommen. Bei
unzureichender Milchbildung nimmt man 10 Pflanzen auf 3 Dosen,
auch auf leerem Magen ein. Geben Brusttumore werden 20 Pflanzen
auf 3 Dosen verteilt, auch wieder auf leerem Magen. In der chinesischen
Medizin wird der weiße Milchsaft des Löwenzahns als Antidot
auf Schlangenbisse aufgetragen. In der traditionellen chinesischen
Medizin gilt Löwenzahn als besonders gutes Heilmittel bei Störungen
der weiblichen Geschlechtsorgane, insbesondere der Brüste, und bei
allen Arten von Leberbeschwerden und wird auch nach durchzechten Nächten
zur Entlastung der Leber und der Nieren.
Aus den Blüten lässt sich Kunsthonig herstellen. Es gibt zahlreiche
Gerichte und Getränke mit Löwenzahn.
Nebenwirkungen:
Wie bei allen bitterstoffhaltigen Pflanzen kann es zu Magenbeschwerden
kommen. Wenn Kinder den Milchsaft aus den Stengeln der Pflanze saugen,
kann es zu Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen.
Die getrocknete Pflanze darf nicht bei Entzündung oder Verschluß der
Gallenwege, Darmverschluß, Gallenblasenempyem, Ileus angewendet werden.
Bei Gallensteinleiden nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden. Nach
Kontakt mit dem Milchsaft wurden selten Hautallergien beobachtet. Wechselwirkungen
sind nicht bekannt.
Zur Giftigkeit:
Der Löwenzahn enthält in allen Teilen Triterpene,
unter anderem auch Taraxerol, denen jedoch keine größere toxische Bedeutung
zukommt. Insofern sind Berichte über Vergiftungen mit Löwenzahn eher
kritisch zu bewerten. Trotzdem kann Löwenzahn in grösseren
Mengen dauerhaft gegessen, leberschädigend wirken.
Geschichtliches:
Die arabischen Ärzte Rhazes und Ibn Sina (Avicenna) erwähnen
den Löwenzahn zuerst, doch dürfte die Kenntnis von seiner
Heilwirkung von den Griechen übernommen worden sein. Auch die Kräuterbücher
des 16. Jahrhunderts empfehlen die Droge.
|
Löwenzahn

Zeichnung: Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)
Bei Klick auf das Bild sehen Sie das Bild in einer Grösse
von 1000 Pixeln Breite
(lange Ladezeit!)
Herbstlöwenzahn

Bilder mit freundlicher Genehmigung von
Kurt Stübers
Fotos: © L. B. Schwab
Löwenzahn an Baustelle

Hinter Gittern

Blüte

Samenstand

|